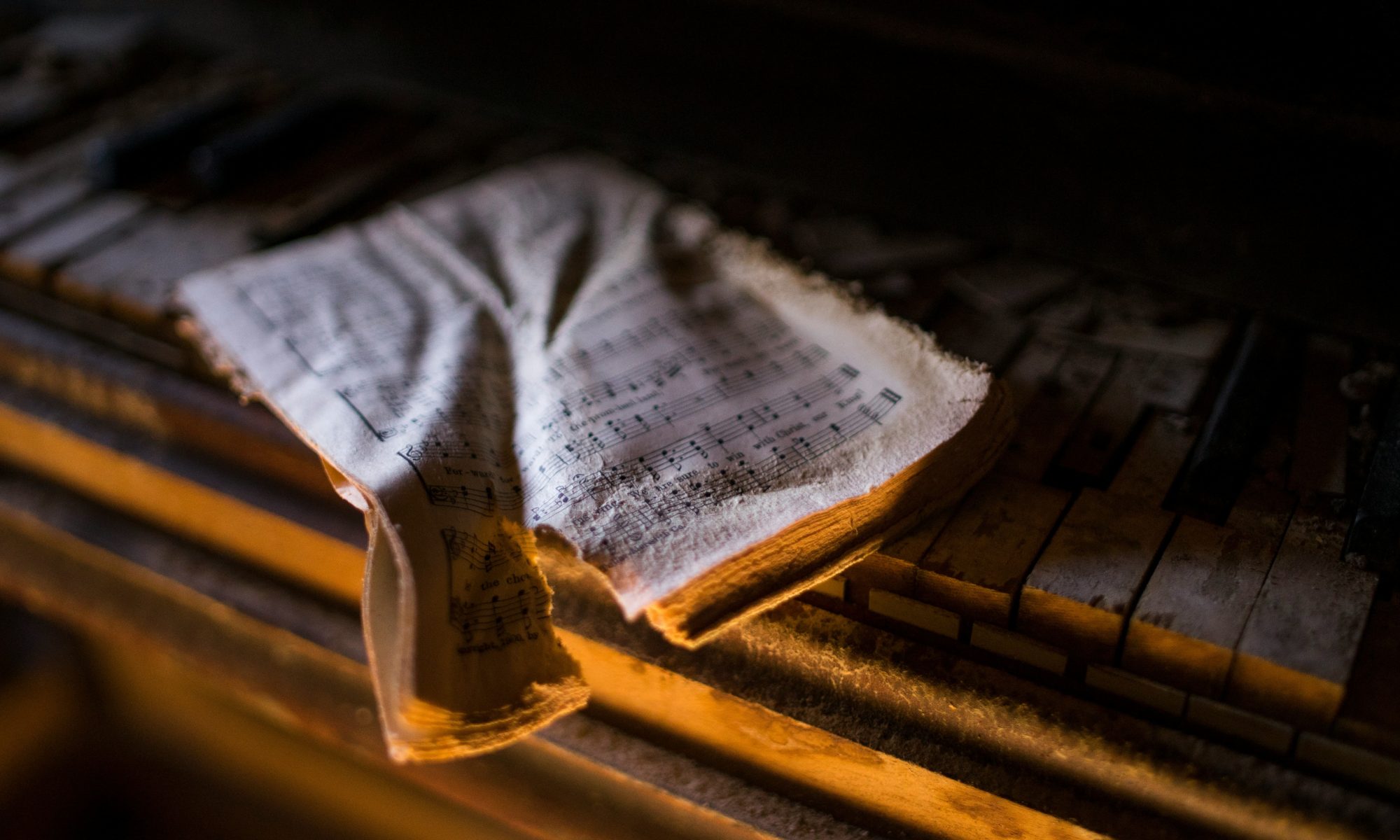Warum Urteilsvermögen heute wichtiger ist denn je – ein Blick aus der Perspektive einer professionellen Musikpädagogin
In den letzten Jahren hat sich die Art und Weise, wie Menschen ein Instrument lernen, grundlegend verändert.
YouTube, Instagram und TikTok haben eine neue Generation von „Online-Lehrer*innen“ hervorgebracht – leicht zugänglich, sympathisch und scheinbar kompetent.
Doch in einer Zeit, in der Informationen überall verfügbar sind, wird Urteilsvermögen zur entscheidenden Fähigkeit:
Wie unterscheidet man zwischen wertvollem Wissen und gefährlicher Vereinfachung?
Und was passiert, wenn autodidaktisches Lernen auf falschen Grundlagen aufbaut?
Falsches Lernen – eine unterschätzte Gefahr
Ohne kritisches Denken ist es heute leicht, Halbwissen oder falsche Methoden zu übernehmen.
Für Hobbyspieler*innen ist das vielleicht harmlos.
Doch für jene, die ernsthaft eine musikalische Karriere anstreben, kann ein falscher Ansatz zu langfristigen Schäden führen – technisch, körperlich und mental.
Beispiel 1: Fehlgeleitete Dynamik
Ein Klavierlehrer verbreitete kürzlich auf Social Media die Empfehlung, beim leisen Spielen den Oberkörper näher an die Tasten zu bringen und beim lauten Spielen wieder zurückzugehen.
Für Laien mag das zunächst einleuchtend wirken – technisch ist es auf Dauer jedoch grundlegend falsch. Vielleicht scheint (nicht klingt) die Musik durch die Körpersprache lebendiger, aber das Entscheidende wurde dabei völlig übersehen:
die Finger, aus denen der Klang entsteht.
Es wurde gar nicht erklärt, wie man sich einen ästhetischen Klang überhaupt vorstellt und was genau in Fingern, Handgelenk, Arm, sogar beim Zuhören geschehen muss, damit ein wirklich schöner Ton entsteht.
Jede professionell ausgebildete Musiker*in würde das sofort erkennen.
Beispiel 2: Das Missverständnis beim Terzenspiel
Ein amerikanischer Student von mir schickte mir kürzlich ein Video einer populären „Influencer-Klavierlehrerin“.
Thema des Videos: die Technik der Terzen, etwa wie sie in Chopins Etüde Op. 25 Nr. 6 vorkommen.
Obwohl diese Influencerin einen Abschluss einer amerikanischen Musikhochschule besitzt, war ihre Erklärung stark vereinfacht, und ihre eigene Spieltechnik offenbar ebenfalls eingeschränkt.
Erfahrene Pädagog*innen und Musiker*innen wissen:
Technische Probleme sind individuell.
Was bei einem Schüler funktioniert, kann beim nächsten völlig andere Ergebnisse zeigen.
Wer ausschließlich über Online-Videos lernt, riskiert, sich falsche Bewegungen anzueignen, die später – nach meiner Erfahrung – in rund 80 % der Fälle kaum noch korrigierbar sind.
Übrigens: Ich studiere derzeit Musikphysiologie in an der Universität für Musik und darstellende Kunst Wien, und alle dortigen Kolleg*innen betonen immer wieder die gravierenden langfristigen Folgen schlechter motorischer Gewohnheiten.
Über die Entwicklung von Urteilsvermögen
Ich ermutige meine Schüler*innen ausdrücklich, selbstständig zu lernen, denn es gibt so vieles, das man wissen und entdecken kann, wenn man gut musizieren möchte. Außerdem findet man im Internet zahlreiche hochwertige Inhalte, die das eigene Lernen wunderbar unterstützen können.
Doch ohne die Fähigkeit, Qualität zu erkennen, kann Fleiß leicht ins Gegenteil umschlagen.
Man lernt dann mit großem Engagement, aber in die falsche Richtung, mit dauerhaften Folgen.
Urteilsvermögen wächst durch Erfahrung, Reflexion und Kontextwissen.
Solange man die Zusammenhänge zwischen Körper, Klang, Psyche und Technik nicht wirklich verstanden hat, ist es schwer, den Wert einer Information zu beurteilen.
Ich erinnere mich gut an meine Studienzeit an der Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover:
Täglich war ich von erstklassigen Professor*innen und neuen Ideen umgeben.
Und dennoch brauchte ich Zeit, um zu erkennen, welche Informationen meiner musikalischen Entwicklung wirklich dienten, und welche nur akademisch interessant, aber praktisch nutzlos waren.
Heute, im Austausch mit Kolleg*innen an europäischen Musikhochschulen, sehe ich immer wieder:
Selbst im akademischen Umfeld ist nicht jede Lehrkraft pädagogisch kompetent.
Das Lernen, zu unterscheiden, ist vielleicht die wichtigste Lektion auf dem Weg zur Professionalität.
💡 Tipp: Wenn man sich in einem bestimmten Bereich nicht gut auskennt, kann man zunächst recherchieren, wer die betreffende Person ist und welche Ausbildung sie absolviert hat – also ob sie durch ein anerkanntes Studium oder eine fundierte Berufsausbildung qualifiziert wurde. Ein weiteres gutes Zeichen für Fachkompetenz ist, wenn diese Person regelmäßig zu Veranstaltungen, Vorträgen oder Konzerten in ihrem Fachgebiet eingeladen wird. Auch daran lässt sich oft erkennen, wie anerkannt und geschätzt jemand innerhalb der Fachgemeinschaft ist.
Professionelle Pädagog*innen vs. Influencer-Selbsthilfevideos
Der Unterschied ist grundlegend:
- Professionelle Lehrkräfte verfügen über eine fundierte musikalische Ausbildung, jahrelange Unterrichtserfahrung und ein tiefes Verständnis für individuelle Lernprozesse.
Sie investieren ihre Zeit in ihre Schüler*innen – nicht in Algorithmen. - Influencer-Lehrer*innen hingegen haben oft eine unklare oder unvollständige Ausbildung, gewinnen aber durch Präsentation, Trends und Reichweite schnell an Popularität.
Was auf den ersten Blick wie eine günstigere Alternative wirkt – „Ich spare mir den Unterricht!“ – kann langfristig deutlich teurer werden.
Denn die Kosten, schlechte Gewohnheiten zu korrigieren, sind weitaus höher als die Investition in eine fundierte Ausbildung von Anfang an.
Vor allem, wenn es um eine wirklich gute Lehrkraft geht, lernt man in kürzester Zeit viel effizienter, hat mehr Spaß daran und kommt schneller voran als bei jemandem, der vielleicht nur sagt: „Spielt bitte nochmals“ oder „Übt einfach mehr!“
Schlussgedanke
Selbstständiges Lernen ist großartig – aber nur, wenn es von kritischem Denken begleitet wird.
Urteilsvermögen ist im digitalen Zeitalter keine Option, sondern eine Notwendigkeit.
Gerade für Musiker*innen gilt:
Nicht alles, was im Internet plausibel klingt, ist wahr oder nützlich.
Natürlich, muss man mir ja gar nicht glauben 😉
Über den Autorin
Jui-Lan Huang ist Pianistin und Klavierdozentin am Schubert Konservatorium Wien. Sie wurde an der Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover ausgebildet.
Sie unterrichtet international und vertieft derzeit im Rahmen eines Studiums in Wien ihre Kenntnisse in Musikphysiologie und Musikpsychologie.
Ihr besonderes Interesse liegt in der Verbindung von Klaviertechnik, mentalem und körperlichem Bewusstsein sowie der Klanggestaltung. Darüber hinaus teilt sie regelmäßig ihre Erkenntnisse und praxisnahen Tipps auf Threads sowie in ihrem eigenen Blog, um Musiklernende weltweit bei effektivem Lernen und gesundem Üben zu unterstützen.